Conners Skalen zu Aufmerksamkeit und Verhalten für Erwachsene
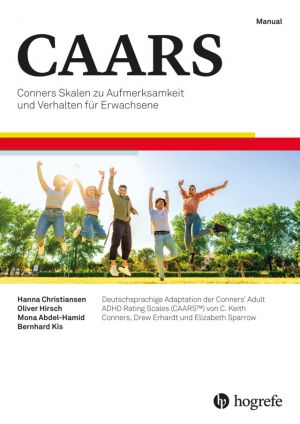
Die Conners Skalen zu Aufmerksamkeit und Verhalten für Erwachsene (CAARS) – international als Conners’ Adult ADHD Rating Scales bekannt – sind standardisierte Fragebögen zur Erfassung von ADHS-Symptomen und alltagsrelevanten Beeinträchtigungen im Erwachsenenalter.[1] Sie werden für Screening, Differenzialdiagnostik, Therapieplanung und Verlaufskontrolle eingesetzt und ergänzen Anamnese, Interview und ggf. neuropsychologische Tests.
Aufbau und Versionen
CAARS liegt als Selbstbericht und Fremdbericht vor. Letzterer wird typischerweise von Partnern, Angehörigen oder Kollegen ausgefüllt. Es gibt Langformen für ein differenziertes Profil und Kurzformen für ökonomisches Screening und Verlaufsmessung. Die Antworten erfolgen auf einer vierstufigen Likert-Skala („nie“ bis „sehr häufig“) bezogen auf das aktuelle Verhalten. Rohwerte werden in T-Werte (M = 50, SD = 10) transformiert; T ≥ 65 gilt oft als auffällig, muss aber kontextsensitiv interpretiert werden. Neuere Fassungen (z. B. CAARS-2) aktualisieren Items, Normen und DSM-Bezüge; Umfang und Normierung variieren nach Sprachversion.
Inhaltsbereiche
Die Skalen bilden zentrale ADHS-Domänen ab: Unaufmerksamkeit/Arbeitsgedächtnis (Desorganisation, Vergesslichkeit, Ablenkbarkeit), Hyperaktivität/innere Unruhe (motorische/mentale Getriebenheit), Impulsivität (vorschnelles Handeln, Unterbrechen) und emotionale Labilität (Reizbarkeit, rasche Stimmungswechsel). DSM-bezogene Subskalen bündeln die Kernsymptome zu unaufmerksamen und hyperaktiv-impulsiven Clustern sowie einem Gesamtscore; ein ADHS-Index fungiert als knapper Indikator für Auffälligkeit.
Anwendung
In der Diagnostik dienen CAARS der Hypothesenbildung bei Verdacht auf ADHS; in der Differenzialdiagnostik helfen Profilmuster bei der Abgrenzung gegenüber Angst, Depression, Schlaf- und Substanzproblemen. In der Therapieplanung unterstützen sie Psychoedukation und Behandlungsentscheidungen, und in der Verlaufskontrolle dokumentieren sie Veränderungen unter Medikation oder Psychotherapie.
Auswertung und Interpretation
Empfohlen ist ein Mehrquellenansatz: Selbst- und Fremdbericht werden verglichen; Übereinstimmung stärkt, Diskrepanzen liefern diagnostische Hinweise (z. B. situationsabhängiges Verhalten, Krankheitseinsicht). Wichtiger als einzelne Grenzwerte ist das Profil über alle Skalen. Eine Diagnose ergibt sich nicht aus Fragebogenscores allein, sondern aus strukturiertem Interview, Lebensverlaufsanamnese (inkl. Kindheit), und dem Nachweis aktueller Funktionsbeeinträchtigungen. Kontextfaktoren wie Schlaf, Stress, Substanzen oder Komorbiditäten müssen explizit berücksichtigt werden.
Gütekriterien
Bei nahezu allen Skalen zeigen sich für beide Geschlechter und über alle Altersstufen hinweg ausgezeichnete interne Konsistenzen (Cronbachs Alpha α > .85). Die übrigen Skalen erreichen überwiegend noch akzeptable Werte (α > .70). Die Retest-Reliabilitäten der Selbstbeurteilungen sind durchweg signifikant und sehr hoch (r = .74–.93), was auf eine starke zeitliche Stabilität der Skalen hinweist. Auch die Fremdbeurteilungen weisen signifikante, hohe Retest-Reliabilitäten auf (r = .64–.85), wenn auch insgesamt etwas niedriger als die der Selbstbeurteilungen.

